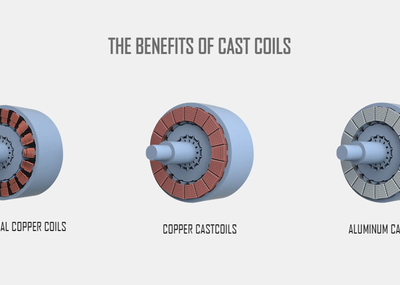Die Automobilindustrie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Während Stahlfelgen lange Zeit der Standard waren, setzte sich ab den 1990er-Jahren das leichtere, korrosionsbeständige Aluminium durch. Doch der Werkstoff bringt nicht nur Vorteile – vor allem seine energieintensive Herstellung und der hohe CO₂-Ausstoß werfen Fragen zur Nachhaltigkeit auf. Im Vergleich zu Rohstahl verursacht die Primäraluminiumproduktion etwa das Zehnfache an Emissionen.
Genau hier setzt das der Bundesrepublik Deutschland geförderte Projekt „SUPA-Wheel“ (Sustainable Production of Aluminium Wheels) des Fraunhofer-Instituts für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV an. Ziel: Den Anteil von recyceltem Aluminium in der Felgenproduktion auf mindestens 30 Prozent zu steigern.
Geschlossene Kreisläufe statt Abfall
„Wir wollen gemeinsam mit unseren Projektpartnern die Umweltbelastung deutlich reduzieren und gleichzeitig Ressourcen schonen“, sagt Robert Kleinhans, der am Fraunhofer IGCV in Garching an innovativen Gießverfahren und Werkstoffen arbeitet. „Dafür prüfen wir, wie sich recyceltes Aluminium effizienter nutzen lässt.“
Die Forschenden orientieren sich dabei am Cradle-to-Cradle-Prinzip – ein Design- und Produktionskonzept, das darauf abzielt, Abfall zu vermeiden und Rohstoffe möglichst vollständig wiederzuverwenden. Alte Felgen sollen dabei nicht entsorgt, sondern direkt in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.
Qualität beim Recycling als Knackpunkt
Recyceltes Aluminium birgt allerdings Herausforderungen. „Verunreinigungen können die Festigkeit und Langlebigkeit der Felgen beeinträchtigen – ein absolutes No-Go bei sicherheitsrelevanten Bauteilen“, so Kleinhans. Entscheidend sei daher eine präzise Analyse der Wechselwirkungen zwischen den Elementen in der Legierung, um die hohen Qualitätsstandards der Automobilindustrie einzuhalten.
Dazu entwickeln die Forschenden eine Matrix aus verschiedenen Aluminiumlegierungen mit unterschiedlichen Elementgehalten. So lassen sich die Zusammenhänge zwischen Zusammensetzung und Materialeigenschaften systematisch erfassen. „Das ist wie bei einem Kuchenrezept: Mehr Kupfer macht die Legierung fester, erhöht aber auch die Korrosionsgefahr. Am Ende müssen alle ‚Zutaten‘ perfekt aufeinander abgestimmt sein.“ Für diese Methodik hat das Team bereits ein Patent beantragt.
Nachhaltig – und wirtschaftlich attraktiv
Sekundäraluminium punktet nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch: Seine Herstellung benötigt nur rund sieben Prozent der Energie, die für Primäraluminium erforderlich ist. Das senkt die Kosten und hilft Automobilherstellern, strengere Vorgaben zur CO₂-Reduktion zu erfüllen.
Langfristig sieht Kleinhans einen klaren Handlungsbedarf: „Es braucht Investitionen in moderne Sortier- und Recyclingtechnologien, um die Reinheit und Qualität von Sekundäraluminium zu sichern. Nur so lässt sich der Marktanteil von Recyclingmaterial nachhaltig steigern.“
Quelle: Fraunhofer IGCV