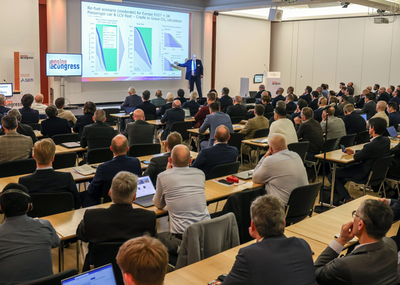In einer richtungsweisenden Rede auf der VDI-Tagung Dritev 2025 skizzierte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), vor Ingenieurinnen und Ingenieuren die zentralen Herausforderungen, Chancen und notwendigen politischen Weichenstellungen für die Transformation der deutschen Automobilindustrie. Ihr Appell: Die Branche könne den Weg zu Klimaneutralität und Digitalisierung nur erfolgreich beschreiten, wenn Politik, Gesellschaft und Industrie gemeinsam verlässliche Rahmenbedingungen schaffen.
1. Mobilität als Teilhabe – das Auto bleibt unverzichtbar
Müller betonte die zentrale Rolle des Automobils für individuelle Mobilität, insbesondere im ländlichen Raum, wo der öffentliche Nahverkehr oft unzureichend sei. Das eigene Auto sichere soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Entgegen gängiger Meinungen sei auch das Interesse junger Menschen am Auto ungebrochen – aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts zeigen einen historischen Höchststand an Pkw-Halterinnen und -Haltern unter 25 Jahren.
2. Transformation verlangt tiefgreifenden Wandel
Die klimaneutrale, digital vernetzte Mobilität der Zukunft stelle die Industrie vor enorme Herausforderungen. Neben massiven Investitionen seien neue politische Rahmenbedingungen notwendig. Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheiten und hohe Energiepreise verschärften die Lage – insbesondere für den industriellen Mittelstand, zu dem viele Gießereien zählen. Selbst große OEMs und Zulieferer geraten unter Druck.
-
Forderung: Die europäische Automobilindustrie muss klimaneutral und digital in die Zukunft investieren, um den Wandel zu bewältigen.
3. Globale Wettbewerbsfähigkeit – China als Gradmesser
China wachse mit rasanter Geschwindigkeit zum Technologieführer. Müller betonte, dass europäische Hersteller nur mit marktgerechten, regional angepassten Produkten – von digitalen Features bis hin zu Designvorlieben – konkurrenzfähig bleiben könnten.
Ob Fahrzeuge in Europa Karaoke-Maschinen sein müssen, sei eine Geschmacksfrage.
Die geopolitischen Spannungen (z. B. US-Zölle) verursachten Milliardenverluste und verdeutlichten die Notwendigkeit strategischer Handelslösungen. Gegenzölle könnten dabei kontraproduktiv sein – insbesondere wenn sie deutsche Fahrzeuge treffen, die in den USA produziert werden. In Europa gebe es dazu naturgemäß unterschiedliche Positionen.
4. Bürokratie und Standortkosten bremsen Innovation
Mit scharfer Kritik wandte sich Müller an Brüssel und Berlin: Überbordende Bürokratie koste rund 22 % der Arbeitszeit – Zeit, die besser in Innovationen investiert wäre. Die hohen Energiepreise – teils fünfmal so hoch wie in Konkurrenzmärkten – gefährdeten zusätzlich die Attraktivität des Industriestandorts Deutschland. Steuerlast und restriktives EU-Beihilferecht trügen zur Verlagerung von Investitionen ins Ausland bei.
5. Energiewende braucht Infrastruktur
Ein wesentliches Hindernis für die Elektromobilität sei die mangelhafte Ladeinfrastruktur. Ein Drittel der deutschen Kommunen habe keine öffentliche Ladesäule, zwei Drittel keinen Schnellladepunkt. Besonders problematisch sei die Situation bei Nutzfahrzeugen – hier dauerten Netzanschlüsse für Betriebshöfe bis zu zehn Jahre. Müller forderte eine neue Energiepolitik, die auch Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe und internationale Energieabkommen einbezieht.
6. Handelspolitik pragmatisch gestalten
Um im globalen Wettbewerb zu bestehen, brauche Europa neue Rohstoff- und Handelspartnerschaften – ohne ideologische Überfrachtung. Müller nannte als Beispiel zollfreie Abkommen Chinas mit afrikanischen Staaten, während europäische Handelsabkommen oft an überzogenen Anforderungen scheiterten.
7. Innovationsfreundliche Gesetzgebung gefordert
Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, KI und neuer digitaler Dienste werde in Europa durch überregulierte Gesetzgebungsverfahren gebremst. Müller warnte, Europa drohe im globalen Rennen um das „Smartphone auf Rädern“ ins Hintertreffen zu geraten. Es brauche gesetzliche Regelungen, die Datenschutz und KI verantwortungsvoll gestalten, aber Innovation ermöglichen.
8. Investitionen sind da – aber Unsicherheit bleibt
Trotz der Herausforderungen investiert die Branche massiv:
-
320 Milliarden Euro fließen in Forschung, Entwicklung und Innovation
-
220 Milliarden Euro in die Transformation von Werken – allein in den nächsten vier Jahren.
Dennoch bleibt die Sorge um den Industriestandort Deutschland, insbesondere in strukturschwachen Regionen, wo politische Radikalisierung zunimmt.
9. Fazit: Industrie ist bereit – Politik muss liefern
Die deutsche Automobilindustrie steht an einem historischen Wendepunkt. Hildegard Müller machte deutlich: Es fehlt nicht am Willen der Industrie – aber die politischen Rahmenbedingungen müssen endlich mit dem Tempo der Transformation Schritt halten. Nur so kann Deutschland seine Rolle als führender Industriestandort behaupten – auch mit Blick auf die Zulieferer und Gießereien als Rückgrat der Industrie.
10. Was bedeutet das für KMU und Gießereien?
Der industrielle Mittelstand – insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und Gießereien als klassische Zulieferer der Automobilindustrie – steht massiv unter Druck. Die Transformation der Branche trifft sie besonders hart.
Zentrale Belastungsfaktoren für KMU und Gießereien:
-
Finanzierungsschwierigkeiten: Engere Bankenvorgaben und hohe Transformationsanforderungen erschweren Kapitalzugang.
-
Hoher Veränderungsdruck: Transformation betrifft ganze Produktions- und Lieferkettenstrukturen.
-
Externe Schocks: Energiepreise, Lieferkettenstörungen und globale Nachfrageverschiebungen schwächen die Wettbewerbsfähigkeit.
-
Politische Rahmenbedingungen: Standortattraktivität und Beschäftigung hängen stark von Entscheidungen in Energiepolitik, Bürokratieabbau und Förderprogrammen ab.
Arbeitsplätze und Strukturwandel
-
Die Beschäftigtenzahl in der Automobilbranche ist bereits auf rund 730.000 gesunken.
-
Ein begleiteter Strukturwandel ist notwendig, um Arbeitsplätze – gerade im Mittelstand – zu sichern.
-
Gießereien, oft stark vom Verbrenner abhängig, müssen klären, wie sie sich in neue Wertschöpfungsketten integrieren können.
Internationale Konkurrenz
-
Der Wettbewerbsdruck – insbesondere aus China – wächst weiter.
-
Während dort neue Giganten mit großem Heimatmarkt entstehen, kämpfen europäische Zulieferer mit hoher Umstellungslast.
-
Dennoch gilt: Ein Überangebot chinesischer E-Autos reicht nicht, wenn europäische Konsumenten andere Anforderungen an Marke, Design und Qualität stellen.
Schlussfolgerung für den Mittelstand
Für KMU und Gießereien geht es um mehr als Transformation – es geht um die Existenz.
Was jetzt gebraucht wird:
-
Verlässliche politische Rahmenbedingungen
-
Gezielte Fördermaßnahmen
-
Eine klare industriepolitische Strategie
Nur so können diese Unternehmen Innovation, Beschäftigung und Wertschöpfung auch künftig in Deutschland sichern.





![[Translate to Deutsch:] [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_220324-VDI_Slider_0a91e6ae93.png)